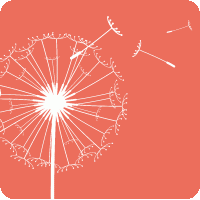Aller Anfang ist …
Der Semesterstart naht und damit die Einstiege in die Lehrveranstaltungen des Wintersemesters 2018/2019. Wer sich nicht der „ewigen Wiederkunft des Gleichen“ ( nach Nietzsche) hingibt, hat sich in den vergangenen Wochen Gedanken über Lehr- Lernszenarien gemacht. Getrieben von Gedanken über die gemeinsamen Lehr-Lernziele, den entsprechenden Leistungsanforderungen und Prüfungsformate sowie die didaktisch-methodischen Wege vom einen zum anderen, ist eine Lehrveranstaltungsarchitektur entstanden. Ein Plan dafür, wie die Inhalte optimal vermittelt werden sollen, wie die Studierenden für die eigenen Inhalte motiviert werden können.
Lernszenarien gemacht. Getrieben von Gedanken über die gemeinsamen Lehr-Lernziele, den entsprechenden Leistungsanforderungen und Prüfungsformate sowie die didaktisch-methodischen Wege vom einen zum anderen, ist eine Lehrveranstaltungsarchitektur entstanden. Ein Plan dafür, wie die Inhalte optimal vermittelt werden sollen, wie die Studierenden für die eigenen Inhalte motiviert werden können.
Nicht wenige Hochschullehrende müssen bei diesen Vorbereitungstätigkeiten nach den eigenen Freiheiten suchen. Wo strukturelle Mauern sind, fachkulturelle Grenzen gesetzt werden und Curricula „immer schon so“ in die Praxis umgesetzt werden, bleibt manchmal wenig Platz für Neuartiges. Der Gegensatz dazu besteht aus frisch gebackenen Absolvent*innen, die mit einem Lehrauftrag betraut werden und eine komplett neue Veranstaltung entwickeln sollen. Hier müssen inhaltliche Grenzen erst gesteckt werden, methodische Möglichkeiten eruiert und die fachkulturellen Eigenheiten erahnt werden. Wer sich zwischen diesen beiden Extremen befindet und Spaß hat, neue didaktisch-methodische Möglichkeiten auszuprobieren, nimmt sich vielleicht eine einzige neue Idee vor und setzt diese in diesem Semester in die Tat um.
Wie dem auch sei – der Grundgedanke hochschuldidaktischer Planungsaktivitäten lautet im Optimalfall „Wie kann ich als Lehrende*r – ausgerüstet mit inhaltlichem Know How – Lernen von Studierenden fördern?“. Die Vermittlungsfrage, wird dann zur Aneignungsfrage. Und alle didaktisch-methodischen Überlegungen erhalten einen Kontext, der spätesten im Seminarraum oder im Hörsaal real wird. Wenn die Studierenden uns „gegenüber“ sitzen und (er-)warten.
Gerüstet mit unserer Lehr-Lernarchitektur eröffnen wir die Veranstaltung. In dem Moment ist nicht wichtig, welche Hürden wir bei der Planung überwunden haben, welche Gedanken wir in unsere Konstruktion gesteckt haben, wie viele Vorgesetze und/oder Kolleg*innen unsere Ideen unterstützt haben. Es ist wichtig, wie sehr wir uns über diese Gelegenheit freuen. Wir sind in der priviligierten Situation Wissen, neue Denkweisen, neue perspektivische Möglichkeiten anzubieten. Wir haben die Gelegenheit die Wahrheiten unseres Fachs zu umkreisen. Wir treten mit den Studierenden (auch in „Massenveranstaltungen“) in einen Dialog, in Beziehung.
Inspiration, wie der richtige Ton für den Einstieg in die Veranstaltung aussehen kann bietet der Artikel „Opening Intentions for the first class“ von dem amerikanischen Dozent Lawrence Lesser. Dieser hat dazu gemeinsam mit seiner Kollegin Kerrie Kephart eine spannende Fallstudie entwickelt. Sehr umfassend in seiner Kategorisierung ist der sogenannte Lehr-Lernvertag, in dem alle wesentlichen Elemente der Veranstaltung vereinbart werden. Wichtig ist dabei folgender Merksatz: Jegliche studentische Einbindung auf dem Weg zur Lernzielerreichung ist motivationsförderlich. Und der Praxisbezug, selbst wenn die Praxis in der wissenschaftlich-forscherischen Tätigkeit liegt, motiviert Studierende. Diese kurze Zusammenfassung der TU München bietet hilfreiche kleine Tipps, die für jeden Veranstaltungstyp geeignet ist und kaum Vorbereitungszeit benötigt.
Ich stelle in vielen hochschuldidaktischen Weiterbildungen die Frage nach inspierenden Hochschullehrenden und deren Eigenschaften. Dabei wird die Begeisterung für das eigenen Fach und die Begeisterungsfähigkeit für Lehr-Lernmomente häufig genannt. Wie „vollendet“ euere Lehr-Lernarchitektur bis dato auch immer ist, nehmt euch ein paar wertvolle Minuten für folgende Fragen: Was freut euch an eurem Fach? Was lässt euch Strahlen, wenn ihr davon erzählt? Und welche Lehrmomente sind es, von denen ihr am Ende des Tages berichten wollt?
Ich wünsche euch einen gelingenden Semesterstart mit viel Beziehung und Begeisterung sowie der Fähigkeit die Unplanbarkeit auszuhalten!