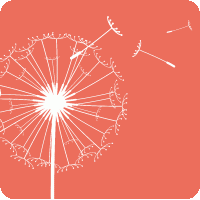Es ist der beschwerliche Weg, den der Empörte beschreiten muss,…
…um als Citoyen Anerkennung zu finden (Oskar Negt)
Rechtzeitig vor dem Sommer habe ich einen Beitrag für ein Herausgeberwerk geschrieben, mit dem Titel „Mündige Bürger*innen als Ziel einer kritischen Hochschullehre“.
In dem Beitrag geht es um die Kritik, Universitäten würden mehr und mehr zu an der Arbeitsmarktpolitik ausgerichteten Ausbildungsstätten, die ihre ursprünglichen Werte vergessen haben. Diese Werte können mit gesellschaftlichen Befreiungsgedanken durch Bildung beschrieben werden. Im Gegensatz dazu lautet der Vorwurf, Lehrende würden durch Publikationsdruck und Bologna-reformierte Lehrveranstaltungsstrukturen lehrendenzentrierter denn je unterrichten (siehe dazu Otto Kruses Beitrag). Den Studierenden – übrigens war mir die Herkunft des Worts Student, aus dem lateinischen als „strebend nach…“ und „sich interessierend für…“ nicht bewusst – wird vorgeworden, sie wären passiv, konsumierend und nicht mehr kritisch. Etwas polemisch, sehr unterhaltsam und letztendlich sehr denkanstoßend habe ich dabei das kleine Büchlein von Christiane Florin empfunden. Mein Lieblingszitat, das mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, war folgendes: „Sie sind einerseits ein anspruchsvolles Publikum, das mit pädagogischer und vortragstechnischer Raffinesse bei Laune gehalten werden will. Sie sind andererseits anspruchslos, was die Inhalte anbetrifft. Es stört sie nicht, wenn sie um Themen und Thesen gebracht werden. Die Lehrpläne sind ohnehin voll genug“ (Florin 2014, S. 10). Solche Realitätschecks stehen in einem epochal-stilistischen und inhaltlichen Widerspruch zu der Magna Charta Universitatum, die ich auf der Suche nach universitären Aufgabenbeschreibungen (wieder) entdeckt habe.
 Auch ich bin als Studentin, insbesondere als Studentin eines bildungswissenschaftlichen Studiums, mit diesen beiden Welten konfrontiert worden. Ich habe erst spät im Studium angefangen zu verstehen, um welche Denkschulen es sich beim Studieren handeln kann, welch vielfältige Perspektiven ich als künftige Bildungswissenschafterin einnehmen werde, und wie anregend Gedankenspiele zu Utopien und Reflexionen über Menschenbilder sind. Wie so viele Studentinnen und Studenten heute, war auch ich im Studium auf der Suche nach den Grundsteinen meiner beruflichen Zukunft. Berufliche, bzw. arbeitsalltägliche Fragen wie „Was will ich werden? Wie möchte ich meinem Arbeitsalltag entgegensehen? Welche Verdienstprognosen ergeben sich aus den verschiedenen Möglichkeiten?“ standen eher im Vordergrund, als selbstreflexive, lebensweltorientierte Fragen „Was ist ein gutes Leben? Welche Rolle(n) möchte ich dabei übernehmen? Wie möchte ich meine und die Welt wahrnehmen? Welche positiven strukturellen Veränderungen möchte ich mitgestalten?“
Auch ich bin als Studentin, insbesondere als Studentin eines bildungswissenschaftlichen Studiums, mit diesen beiden Welten konfrontiert worden. Ich habe erst spät im Studium angefangen zu verstehen, um welche Denkschulen es sich beim Studieren handeln kann, welch vielfältige Perspektiven ich als künftige Bildungswissenschafterin einnehmen werde, und wie anregend Gedankenspiele zu Utopien und Reflexionen über Menschenbilder sind. Wie so viele Studentinnen und Studenten heute, war auch ich im Studium auf der Suche nach den Grundsteinen meiner beruflichen Zukunft. Berufliche, bzw. arbeitsalltägliche Fragen wie „Was will ich werden? Wie möchte ich meinem Arbeitsalltag entgegensehen? Welche Verdienstprognosen ergeben sich aus den verschiedenen Möglichkeiten?“ standen eher im Vordergrund, als selbstreflexive, lebensweltorientierte Fragen „Was ist ein gutes Leben? Welche Rolle(n) möchte ich dabei übernehmen? Wie möchte ich meine und die Welt wahrnehmen? Welche positiven strukturellen Veränderungen möchte ich mitgestalten?“
 Wie es der Zufall so wollte, hatte ich noch während des Studiums die Gelegenheit, mich bei der Erstellung eines persönliches Kompetenzportfolios begleiten zu lassen. Über die Frage „Was kann ich alles?“ und „Was noch so?“ konnte ich mich ein wenig beruhigen. Wenn meine Antworten auf diese Frage ausreichen, um arbeitsmarktfähig zu sein, kann ich mich ruhig wieder den fauleren Seiten (über den Wert von Muße war ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst) meines Studentinnenlebens widmen. Der Gedanke nach einem inhaltlich ansprechenden Lebenslauf hat mich jedoch bei keinen meiner bildungs- und berufsbiographischen Entscheidungen losgelassen. Interessanterweise war es genau diese Tatsache, die meine Entwicklung zu einer (zugegebenermaßen selbsternannten) mündigen Bürgerin, vorangetrieben hat: Die Immatrikulation ins Doktoratstudium. Diese Entscheidung hat meine beruflichen Anfänge als selbstständige Unternehmerin in der Bildungsarbeit ausgeglichen. Das Doktoratstudium hat mir endgültig die Chancen meiner Studieninhalte vor die Nase gehalten. Ironisch, dass das Streben nach einem arbeitsmarktfähigen, attraktiven Lebenslauf es mir ermöglicht, genau diese Praxis in Frage zu stellen.
Wie es der Zufall so wollte, hatte ich noch während des Studiums die Gelegenheit, mich bei der Erstellung eines persönliches Kompetenzportfolios begleiten zu lassen. Über die Frage „Was kann ich alles?“ und „Was noch so?“ konnte ich mich ein wenig beruhigen. Wenn meine Antworten auf diese Frage ausreichen, um arbeitsmarktfähig zu sein, kann ich mich ruhig wieder den fauleren Seiten (über den Wert von Muße war ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst) meines Studentinnenlebens widmen. Der Gedanke nach einem inhaltlich ansprechenden Lebenslauf hat mich jedoch bei keinen meiner bildungs- und berufsbiographischen Entscheidungen losgelassen. Interessanterweise war es genau diese Tatsache, die meine Entwicklung zu einer (zugegebenermaßen selbsternannten) mündigen Bürgerin, vorangetrieben hat: Die Immatrikulation ins Doktoratstudium. Diese Entscheidung hat meine beruflichen Anfänge als selbstständige Unternehmerin in der Bildungsarbeit ausgeglichen. Das Doktoratstudium hat mir endgültig die Chancen meiner Studieninhalte vor die Nase gehalten. Ironisch, dass das Streben nach einem arbeitsmarktfähigen, attraktiven Lebenslauf es mir ermöglicht, genau diese Praxis in Frage zu stellen.
Retrospektiv und aktuell beurteile ich mein „Denklager“ als „in Balance“. Mir meine Brötchen auf möglichst angenehme als auch anregende Art zu verdienen, bleibt dabei ein wichtiges Ziel. Dabei darauf zu achten, dass beruflich und/oder privat genug

Momente entstehen, in denen ich systemkritisch und widerständig bin und dadurch in meinem aktuellen Mikrokosmos Veränderungen ermögliche, ist ebenso wichtig. Es darf also auch beides gleichzeitig sein.
Ich hoffe sehr, dass ich in der privilegierten Situation bleiben werde, in der ich mich nicht weiter zu entscheiden brauche.
P.S. Das Zitat in der Blog-Überschrift hat mich daran erinnert, wie wichtig es ist öffentlich zu werden, wenn jemand – und wird es subjektiv als noch so privat empfunden – etwas zu sagen hat. Dies gelingt den Autorinnen und Autoren des Blogs Sozialearbeitistpolitisch meiner Meinung sehr gut.
P.P.S. Ich habe vergessen zu erwähnen, welche Bedeutung diese Recherchen und Diskussionen auf unseren Lehralltag haben könnte. Das dann in einem nächsten Beitrag.
P.P.P.S. Interessanterweise besteht dieser Blogbeitrag aus vielen Fragen. Fragen leiten ja bekanntermaßen das kritische Denken. Wenn also ein Blogbeitrag aus Fragen besteht, wie kann dann Lehre mit so vielen Ausrufezeichen versehen sein?